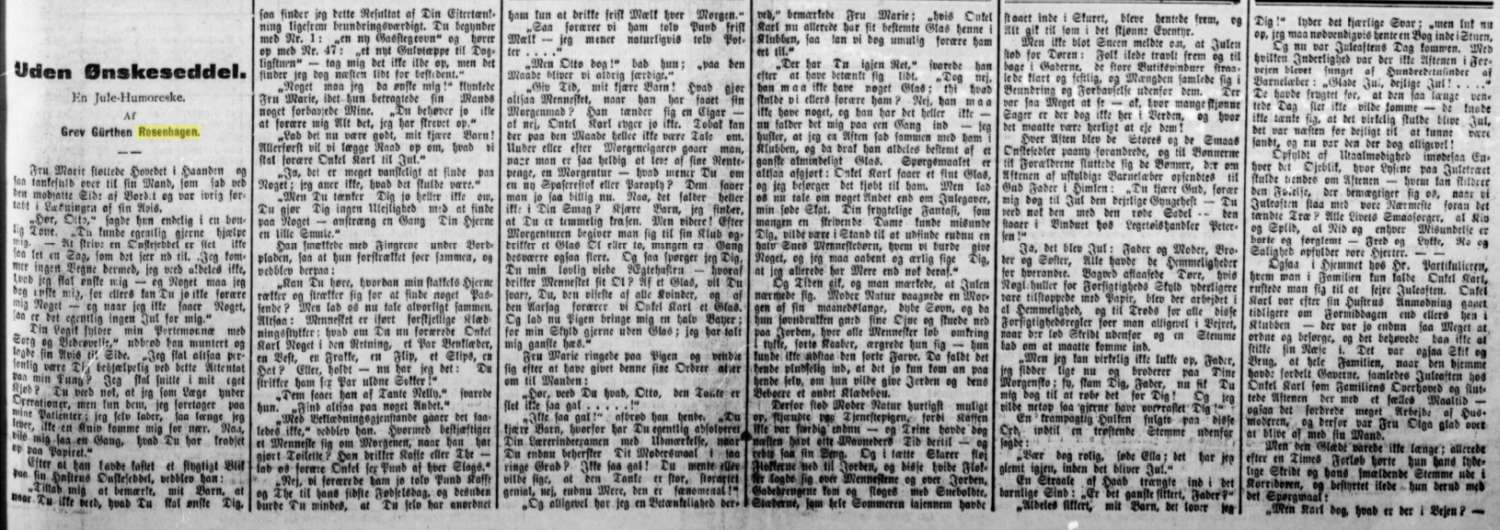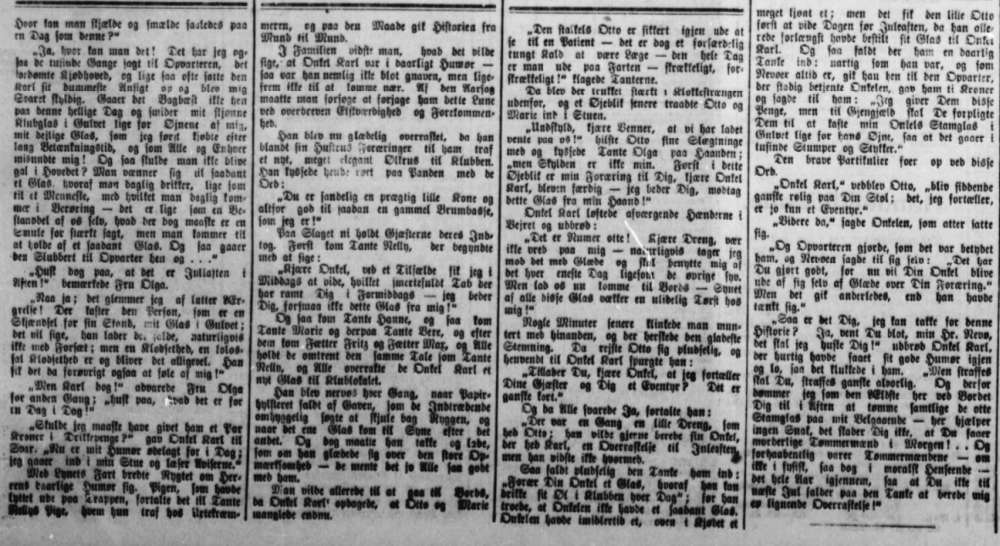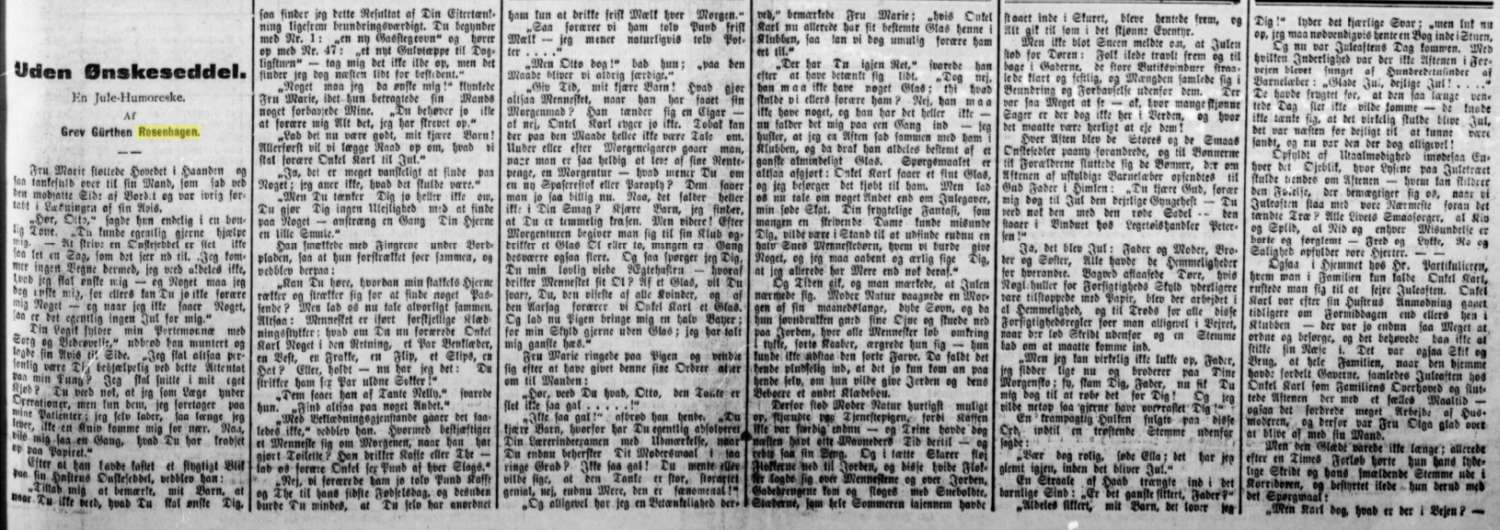
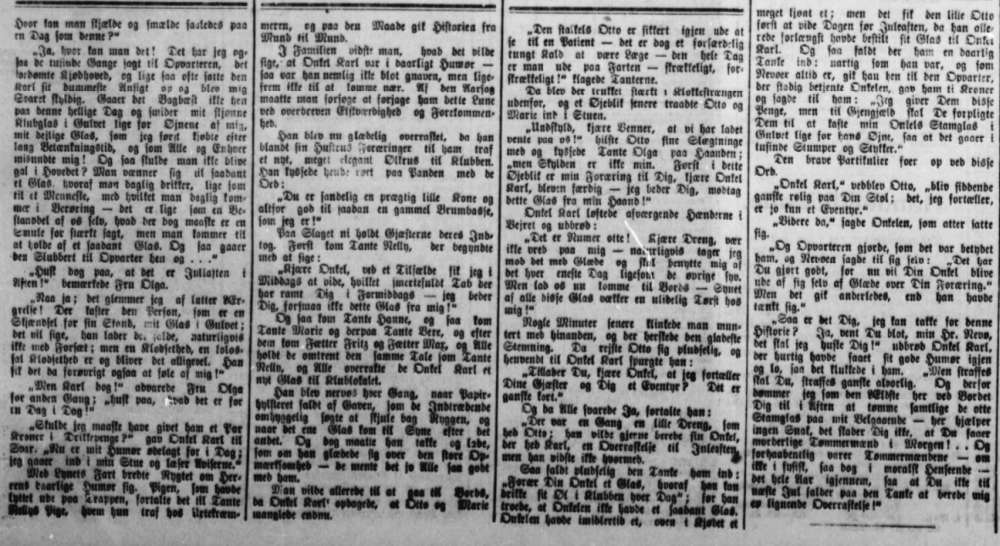
Eine Weihnachts-Humoreske von Graf Günther Rosenhagen
in: „Pittsburger Volksblatt” vom 15.01.1896,
in: „Pittsburger Volksblatt” vom 23.01.1896,
in: „Grenzbote des nordwestlichen Mährens” vom 9.2.1898,
in: „Nationaltidende” vom 27.12.1900 (2.Ausgabe), in dänischer Übersetzung unter dem Titel „Uden Ønskeseddel”
Frau Marie stützte den Kopf auf die Hand und sah nachdenklich zu ihrem Gatten hinüber, der an der anderen Seite des Tisches saß und eifrig in die Lectüre seiner Zeitung versunken war.
„Weißt Du, Otto,” begann sie endlich bittend, „Du könntest mir eigentlich helfen — einen Wunschzettel zu schreiben ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, Ich komme gar nicht von der Stelle, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll, — und etwas wünschen muß ich mir doch, denn sonst kannst Du mir ja nichts schenken — und wenn ich nichts geschenkt bekomme, ist es doch gar kein Weihnachtsfest.”
„Deine Logik erfüllt mein Portemonnaie mit Wehmuth,” lachte er lustig auf, die Zeitung bei Seite legend, „also helfen soll ich Dir auch noch bei dem Attentat gegen meine Börse? Mir selbst ins eigene Fleisch schneiden? Du weißt, als Arzt liebe ich die Operationen, aber nur diejenigen, die ich an meinen Patienten ausführe, ich selbst lasse mir, so lange ich lebe, mit keinem Messer nahe kommen. Na, nun aber zeig' mal her, was Du bisher zu Papier gebracht hast.”
„Na, erlaube mal, Kind,” fuhr er fort, nachdem er einen flüchtigen Blick über den Zettel geworfen hatte, „dafür, daß Du nicht weißt, was Du Dir wünschen sollst, finde ich dieses Ergebnis Deines Nachdenkens bewunderungswürdig. Mit Nr. 1: „ein neuer Grudeofen” beginnst Du und hört mit Nr. 47: „ein neuer Teppich für Deine Wohnstube” auf — nimm mir das nicht übel, aber das finde ich beinahe etwas zu bescheiden.”
„Aber ich muß mir doch etwas wünschen,” klagte Frau Marie, als sie die etwas erstaunte Miene ihres Gatten sah, „Du brauchst mir ja auch nicht alles zu schenken, was ich aufgeschrieben habe.”
„Liebes Kind, laß uns erst gemeinsam berathen, was wir Onkel Karl zu Weihnachten schenken wollen.”
„Ja, da ist es sehr schwer, etwas zu wählen, ich weiß auch nichts.”
„Aber Du denkst ja auch gar nicht nach, Du giebst Dir ja auch gar keine Mühe, etwas zu finden — strenge Dein Gehirn mal etwas an.”
Er schnalzte mit den Fingern unter der Tischdecke, daß sie erschrocken zusammenfuhr: „Hörst Du, wie mein armes Gehirn sich dehnt und streckt, um etwas Passendes zu finden? Nun wollen wir aber ernsthaft reden. Also: der Mensch ist bekleidet miz Kleidern; wie wäre es, wenn wir Onkel Karl irgend ein Kleidungsstück schenkten, ein Beinkleid, eine Weste, einen Rock, einen Kragen, einen Shlips, einen Hut, oder halt — ich hab's, Du strickst ihm sechs Paar wollene Strümpfe.”
„Die bekommt er schon von Tante Nelly,” entgegnete sie, „also suche etwas anderes.”
„Mit der Bekleidung ist es also nichts.” fuhr er fort, „womit beschäftigt sich der Mensch, wenn er morgens Toilette gemacht hat? Er trinkt Kaffee oder Thee — schenken wir ihm von jedem sechs Pfund.”
„Aber wir haben ihm doch erst zwölf Pfund Thee und Kaffee zum Geburtstag geschenkt, und außerdem könntest Du wissen, daß Du ihm selbst verordnet hast, des Morgens nur frische Milch zu trinken.”
„Dann schenken wir ihm zwölf Pfund frische Milch — ich meine natürlich zwölf Liter —”
„Aber Otto,” bat sie, „so kommen wir doch nie zu einem Ende!”
„Abwarten, liebes Kind, also was thut der Mensch, wenn er gefrühstückt hat? Er steckt sich eine Cigarre an — ach nein, Onkel Karl raucht ja nicht. Also mit dem Tabak ist es auch nichts. Während oder nach der Morgencigarre macht man, wenn man das Glück hat, Rentier zu sein, seinen Morgenspaziergang — was meinst Du zu einem neuen Spazierstock oder Regenschirm? Die kann man jetzt so billig bekommen. Auch das findet Deinen Beifall nicht; aber liebes Kind, ich finde, Du bist sehr wählerisch. Also weiter. Nach dem Spaziergang kehrt man im Club ein und trinkt ein oder zwei Glas Bier, manchmal werden es leider ja auch mehr. Und nun frage ich Dich, mein mir vor Gott und dem Menschen angetrautes eheliches Weib — woraus trinkt der Mensch sein Bier? Aus einem Glas, antwortest Du weiseste aller Frauen, und darum schenken wir Onkel Karl ein Glas. Und nun laß das Mädchen mir eine Flasche Bier bringen, meinetwegen ohne Glas, ich habe mich heiser geredet.”
Frau Marie klingelte dem Mädchen und wandte sich, nachdem sie befohlen hatte, dem Herrn eine Erfrischung zu bringen, wieder ihrem Gatten zu: „Weißt Du, Otto, der Gedanke ist gar nicht so übel —”
„Nicht übel?” unterbrach er sie, „liebes Kind, wozu hast Du eigentlich mit Auszeichnung Dein Lehrerinnenexamen gemacht, wenn Du noch heute die deutsche Sprache so wenig beherrschst? Nicht so übel — Du meintest oder wolltest sagen, der Gedanke ist groß, großartig genial, nein, er ist noch mehr, er ist phänomenal!”
„Und doch kommt mir ein Bedenken,” antwortete Frau Marie, „wenn Onkel Karl nun schon ein Stammglas im Club hat, können wir ihm doch unmöglich noch ein zweites dazu schenken?”
„Da hast Du mal wieder Recht,” entgegnete er nach einigem Besinnen, „aber nein, er darf kein Glas haben, denn was sollten wir ihm sonst schenken? Nein, er darf keins haben, und er hat auch keins — jetzt fällt es mir plötzlich ein, — ich entsinne mich, eines Abends, an dem ich zusammen mit ihm im Club saß — ich weiß es ganz genau, da trank er aus einem ganz gewöhnlichen Bierseidel. Also der Fall wäre erledigt, Onkel Karl bekommt ein Stammglas, laß mich nur machen, ich werde es selbst besorgen. Nun aber, Geliebteste, laß uns von etwas anderem sprechen, als von Geschenken. Deine fruchtbare Phntasie, um die Dich manche schriftstellernde Geschlechtsgenossin beneiden könnte, wäre im Stande, noch ein halbes Dutzend Menschenkinder zu finden, denen wir etwas schenken müßten, und ich muß Dir offen und ehrlich sagen, ich habe deren mehr als genug.”
Und die Zeit gieng dahin und man merkte, daß es Weihnachten wurde. Frau Holle erwachte eines Morgens aus ihrem monatelangen tiefen Schlaf, und als sie sich schlaftrunken die Augen rieb und zur Erde hinabblickte, auf der alle Menschen in dicke schwarze Mäntel gehüllt herumliefen, ärgerte sie sich — sie konnte die schwarze Farbe nicht ausstehen. Da fiel ihr plötzlich ein, daß es ja nun an ihr läge, der Erde und deren Bewohnern ein anderes Kleid zu geben. So stand sie denn schnell auf und machte Toilette, zankte mit dem Dienstmädchen, weil der Kaffee nicht fertig war — und die Trine hatte doch fast acht Monate Zeit dazu gehabt — und machte dann ihr Bett. Und in dichten Schaaren flogen die Flocken zur Erde nieder, und die weißen Flocken legten sich auf die Menschen und auf die Erde, die Straßenbuben kamen und schneeballten sich, der Schlitten, der den ganzen Sommer auf dem Boden gestanden hatte, wurde wieder heruntergeholt, und alles trug sich zu wie in dem schönen Märchen.
Aber nicht nur der Schnee verkündete die nahe Weihnachtszeit: Geschäftig eilten die Leute in den Straßen hin und her, hell und festlich erleuchtet erstrahlten die großen Schaufenster der Läden, vor denen die Menge sich bewundernd und staunend staute.So viel gab es zu sehen — ach, was giebt es doch für schöne Sachen auf der Welt, und wie herrlich muß es sein, sie zu besitzen! Jeden Abend wurden die Wunschzettel der Großen und der Kleinen von Neuem geändert, und zu den Bitten an die Eltern gesellten sich die Bitten, die Abends von unschuldigen Kinderlippen zum Vater im Himmel gesandt wurden: „Lieber Gott, schenke mir doch zu Weihnachten das schöne Schaukelpferd, — Du weißt ja, das mit dem rothen Sattel, — es steht bei Kaufmann Schulz im Fenster!”
Ja, es wurde Weihnacht: Vater und Mutter, Bruder und Schwester — Alle hatten sie vor einander Geheimnisse. Hinter verschlossenen Thüren, deren Schlüssellöcher zur Vorsicht noch mit Papierpfropfen zugestopft waren, wurde heimlich gearbeitet, und mit lautem Aufschrei fuhr man trotz dieser Sicherheitsmaßregeln in die Höhe, wenn draußen ein Schritt erklang und eine Stimme um Einlaß bat.
„Aber Papa, ich kann nicht aufmachen, ich arbeite ja gerade an Deinen Morgenschuhen — pfui, Papa, nun hast Du mich doch so weit gebracht, daß ich es Dir verrieth! Und ich wollte Dich so recht überraschen!”
Krampfhaftes Schluchzen folgte diesen Worten, bis von draußen eine tröstende Stimme mahnte:
„Aber Ella, beruhige Dich doch, ich vergesse es bis Weihnachten wieder.”
Ein Hoffnungsstrahl durchzuckt ihr kindliches Gemüth: „Ganz bestimmt Papa?”
„Ganz bestimmt, mein Kind, ich verspreche es Dir,” klingt es herzhaft zurück, „nun aber mach' auf, ich muß mir nothwendig ein Buch aus der Stube holen.”
Und nun war der Weihnachtstag da. Mit welcher Inbrunst war nicht am Abend vorher aus Hunderttausenden von Kinderlippen das Lied gesungen worden: „Einmal werden wir noch wach. — Heissah, dann ist Weihnachtstag!”
Sie hatten gefürchtet, daß der so lang ersehnte Tag doch noch nicht kommen würde, — sie konnten sich nicht denken, daß es wirklich, wirklich Weihnachten würde, es war fast zu schön, um wahr zu werden, und nun war es doch da. Voll Ungeduld sah Jeder dem Augenblick entgegen, wo am Abend die Lichter des Tannenbaums entzündet wurden, — wer kann das Gefühl schildern, das uns befällt, wenn wir am Weihnachtsabend mit den Unsrigen vor dem brennenden Tannenbaum stehen? Alle kleinlichen Sorgen des Lebens, aller Haß und Streit, aller Neid und jede Mißgunst ist verflogen und vergessen — Friede und Glück, Ruhe und Seligkeit erfüllt unsere Herzen.
Auch in dem Hause des Herrn Rentiers, in der Familie kurzweg Onkel Karl genannt, rüstete man sich das Weihnachtsfest zu begehen. Früher als sonst war Onkel Karl auf Bitten seiner Frau zum Frühschoppen gegangen — es gab ja noch so vieles zu besorgen und zu thun, wovon er nichts zu wissen brauchte. Auch war es Sitte, daß an jedem Weihnachtsabend sich alle Verwandten, wenn sie zu Hause beschert hatten, bei Onkel Karl, als dem Familienältesten, einfanden und dort bei einem einfachen Abendessen gemeinsam den Tag beschlossen — auch das erforderte für die Hausfrau viel Arbeit. und so war Frau Olga froh, als sie ihren Gatten los war.
Aber die Freude war nicht von langer Dauer; schon nach einer Stunde hörte sie seine lauten Schritte und seine scheltende Stimme auf dem Corridor, und besorgt eilte sie herbei: „Aber Karl, was hast Du nur — heute am heiligen Weihnachtstag so zu fluchen — wie kann man nur!”
„Ja, wie kann man nur! Das habe ich dem Schafskopf von einem Kellner zehntausendmal gesagt, und ebenso oft machte der Kerl sein dümmstes Gesicht und blieb mir die Antwort schuldig. Wirft der Kerl mir am heiligen Weihnachtstag, vor meinen Augen, meinen schönen Stammseidel auf die Erde, mein schönes Glas, das ich mir erst nach langem Besinnen kaufte, um das mich Jedermann beneidete! Und da soll man nicht wüthend werden? Man gewöhnt sich an solch ein Glas, aus dem man täglich trinkt, wie an einen Menschen, mit dem man täglich in Berührung kommt, — es ist gleichsam ein Theil unserer selbst, vielleicht ist das ein bischen zu viel gesagt, aber man gewinnt solch Glas lieb. Und nun läßt der Kellner, dieser Esel — —”
„Aber Karl, heute ist Weihnachten,” mahnte Frau Olga.
„Ach so, ja, ich vergess' vor lauter Aerger, da wirft dieser Mensch, die Schande seines Berufes, mein Glas auf die Erde, das heißt, er ließ es fallen, natürlich nicht absichtlich, aber eine Dummheit, eine grenzenlose Dummheit bleubt es doch! Na, ich bin aber schön mit ihm abgefahren!”
„Aber Karl,” mahnte Frau Olga zum zweiten Mal, „heute ist Weihnacht!”
„Hätte ich ihm vielleicht einen Thaler Trinkgeld geben sollen?” gab er zurück. „Na, die Laune ist mir für heute verdorben, ich will in mein Zimmer gehen und Zeitungen lesen.”
Mit Windeseile verbreitete sich das Gerücht von der schlechten Laune des Hausherrn. Das Dienstmädchen, das auf der Treppe gelauscht hatte, erzählte den Vorfall dem Dienstmädchen von Tante Nelly, das sie beim Krämer traf, und so gieng die Geschichte von Mund zu Mund.
In der Familie wußte man, was es bedeutete, wenn Onkel Karl schlechter Laune war, — dann war er nämlich nicht nur schlechter, sondern sehr schlechter Laune. So mußte man denn versuchen, durch große Liebenswürdigkeit und frischen Humor Onkel Karls Sorgen zu verscheuchen.
Er wurde nun freudig überrascht, als er unter den Geschenken seiner Frau einen neuen, sehr eleganten Stammseidel entdeckte. Gerührt küßte er sie auf die Stirn: „Du bist wirklich eine prächtige kleine Frau — viel zu gut und viel zu schade für solchen alten Brummbären, wie ich es bin!” —
Mit dem Glockenschlag neun Uhr hielten die Gäste ihren Einzug. Zuerst kam Tante Nelly: „Lieber Onkel, durch einen Zufall erfuhr ich heute Mittag, welch' schmerzlicher Verlust Dich heute Morgen betroffen hat, — nimm aus meinen Händen, ich bitte Dich, dieses Glas entgegen.”
Und dann kam Tante Hanna, und dann kam Tante Marie, und dann kam Tante Olga, und dann kam Vetter Fritz und Vetter Max, und sie alle hielten ungefähr dieselbe Ansprache wie Tante Nelly, und sie alle überreichten Onkel Karl einen neuen Stammseidel.
Er wurde jedesmal nervös, wenn die Papierhülse des Geschenkes fiel, das die Eintretenden sorgfältig hinter dem Rücken zu verbergen suchten, und wenn ein Glas nach dem anderen zum Vorschein kam. Und doch mußte er danken und so thun, als ob er sich freue über diese große Aufmerksamkeit — sie meinten es ja alle so gut mit ihm.
Schon wollte man zu Tische gehen, als er merkte, daß Otto und Marie ja noch fehlten.
„Der Arme ist gewiß wieder auf Praxis, — es ist doch ein furchtbar schwerer Beruf, Arzt zu sein — den ganzen Tag unterwegs — schrecklich, schrecklich!” klagten die Tanten.
Da wurde draußen heftig am der Glocke gezogen, und einen Augenblick später betraten Otto und Marie den Saal. —
„Verzeiht, Ihr Lieben, wenn wir auf uns haben warten lassen!” begrüßte Otto seine Verwandten und küßte der Tante Olga ritterlich die Hand, „aber es ist nicht meine Schuld. Erst in diesem Augenblick ist mein Geschenk für Dich fertig geworden, lieber Onkel, — nimm, ich bitte Dich, dieses Glas freundlichst von mir an.”
Aber abwehrend erhob dieser die Hände: „Es ist Nr. 8 — aber mein Junge, sei nicht böse — natürlich nehme ich es mit Freuden und werde es, wie die übrigen sieben, täglich gebrauchen. Nun aber zu Tisch — der Anbick dieser vielen leeren Gäser erweckt in mir einen unbändigen Durst!”
Wenige Minuten später klangen die Gläser an einander, und bald herrschte die fröhlichste Stimmung. Da erhob sich plötzlich Otto, und zu seinem Onkel gewendet fragte er: „Gestattet Ihr, daß ich Euch ein Märchen erzähle, es ist ganz kurz?” — und als sie ihm beistimmten, sprach er:
„Es war einmal ein kleiner Knabe, der hieß Otto, der wollte seinen Onkel, der hieß Karl, gern zu Weihnachten mit einem Geschenk überraschen, aber er wußte nicht, womit.
Da kam ihm plötzlich der Gedanke: schenke Deinem Onkel ein schönes Stammglas, denn er glaubte, der Onkel hätte keines. Der Onkel aber hatte doch eins und zwar ein sehr schönes; das erfuhr der Neffe aber erst einen Tag vor Weihnachten, als er sein Glas schon lange bestellt hatte. Und da kam ihm ein schlechter Gedanke: unartig, wie er war, und wie Neffen stets sind, gieng er zu dem Kellner, der den Onkel stets bediente, gab ihm zwanzig Mark und sprach: „Dieses Geld schenke ich Ihnen, aber dafür müssen Sie sich verpflichten, das Stammglas meines Onkels morgen vor seinen Augen auf den Boden zu werfen, daß es in tausend Splitter geht.”
„Onkel Karl, bleibe ruhig auf Deinem Stuhl sitzen, das Ganze ist ja nur ein Märchen.”
„Und der Kellner that, wie ihm gehießen, und der Neffe sprach zu sich: „Das hast Du schlau angefangen, denn nun wird Dein Onkel vor Freude über Dein Geschenk ganz außer sich gerathen.” Aber es kam anders, als er dachte.
„Also Du bist der Schändliche gewesen, na warte, mein Herr Neffe, das werde ich Dir gedenken!” lachte Onkel Karl, der schnell seine gute Laune wiedergefunden hatte. „Strafe aber muß sein, schwere Strafe. Und deshalb verurtheile ich, als der Aelteste der Tafelrunde, Dich dazu, die sämmtlichen acht Stammgläser heute Abend auf mein Wohl zu leeren — keine Widerrede, es schadet Dir gar nichts wenn Du morgen einen Kater hast.”
„Und hoffentlich hält der Katzenjammer — wenn auch nicht der physische, so doch wenigstens der moralische, das ganze Jahr an, damit Du nächste Weihnachten nicht wieder auf den Gedanken kommst, mir eine solche Ueberraschung zu bereiten.”
„Nationaltidende” vom 27.12.1900 (2.Ausgabe)