

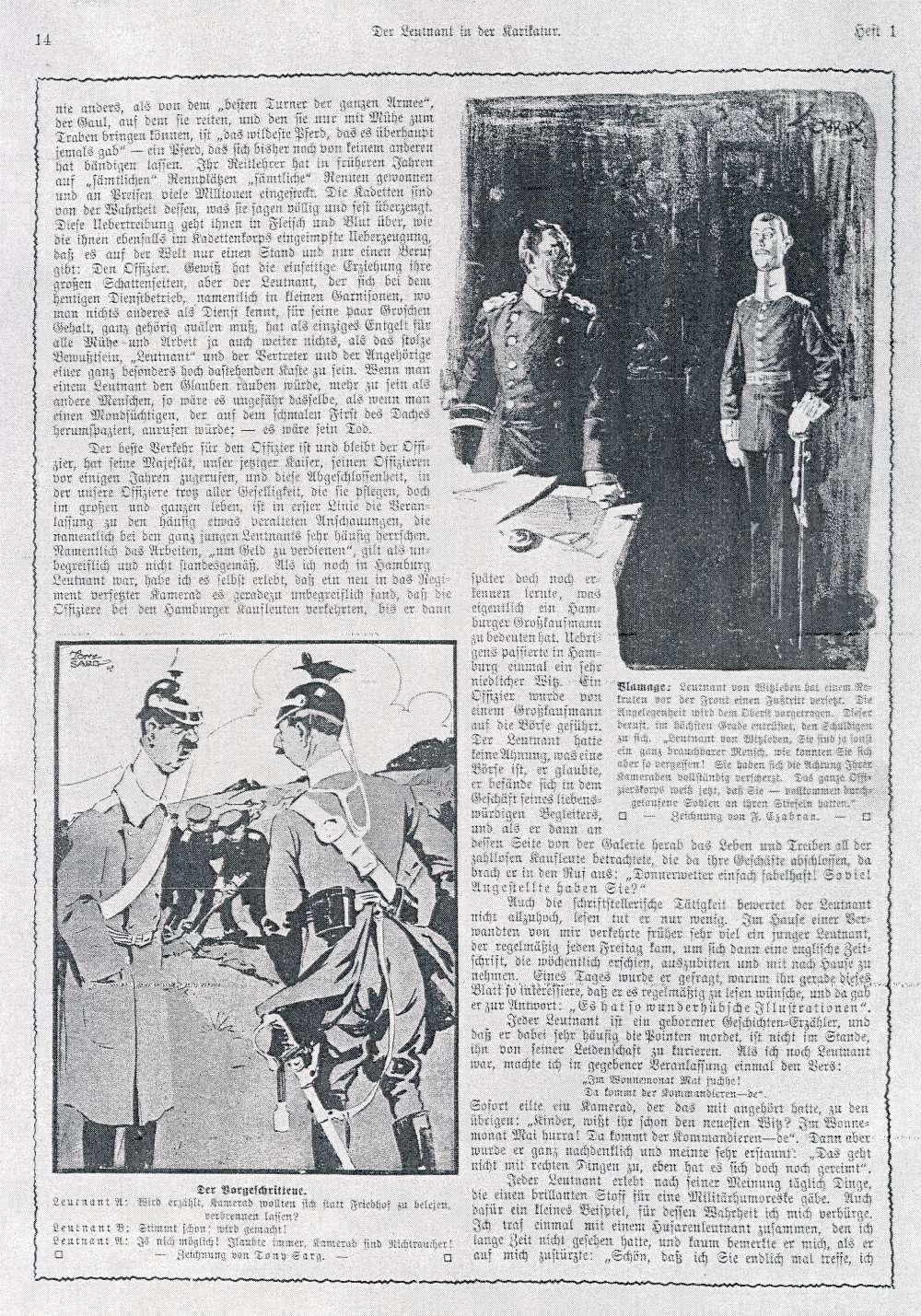

Zum Vergrößern ein- bis zweimal anklicken !
Militärische Humoreske von Freiherr von Schlicht
in: „Welt und Haus”, Jhrgg. 9, 1909/10, Nr. 1, 1.10.1909 und
in: „Richtung, Fühlung, Vordermann!”
In unserem Lustspiel „Im bunten Rock”, das ich vor ein paar Jahren mit Franz von Schönthan schrieb, lassen wir dass Soldatenmädel Betty von Hohenegg an einer Stelle zu ihrer Freundin, der schönen und reichen Witwe aus New York sagen: „Gewiß, Anni, bei Euch da drüben mag ja alles viel großartiger sein als bei uns, aber zwei Dinge mußt du in Europa genießen: In Rom das Kolosseum bei Mondscheinbeleuchtung und in Berlin einen preußischen Leutnant, der dir den Hof macht — das ist der Inbegriff aller Seligkeit.”
Und wie sich das in einem Lustspiel auch so gehört, lernt die reiche Amerikanerin einen Leutnant kennen, läßt sich von ihm den Hof machen und heiratet ihn.
Im Leben endet nicht jeder Flirt, den ein junges Mädchen mit einem Leutnant unterhält, mit der Ehe, abgesehen von den finanziellen Gründen, die bei einer Leutnantsheirat sehr in Frage kommen, schon deshalb nicht, weil es garnicht so viele Leutnants gibt, wie da in süßen Träumen von schönen, jungen Damen erwünscht, erhofft und erfleht werden.
Denn die Leutnants sind und bleiben nun einmal für das weibliche Geschlecht „der Inbegriff aller Seligkeit”. Mag ein Zivilist noch so hübsch, noch so klug, noch so liebenswürdig und noch so reich sein, der jüngste Husarenleutnant sticht ihn aus, wenn er in den Saal tritt und die Hacken zusammenschlägt, daß die abgestimmten silbernen Sporen klirren, denn es gibt tatsächlich abgestimmte Sporen, das ist kein Scherz und noch weniger Übertreibung.
Ein Leutnant ist einfach süß, reizend, himmlisch — es gibt für die jungen Mädchen überhaupt nicht genug Worte, um auszudrücken, wie süß ein Leutnant ist.
Aber auch die Leutnants sind nur Menschen, nicht nur, wenn sie ihre bunte Uniform ausgezogen haben und sich dann von einem gewöhnlichen Sterblichen höchstens nur dadurch unterscheiden, daß sie den Scheitel hinten bis auf den Kragen des Nachthemdes durchgezogen und die Schnurrbartbinde selbst für die Nacht umgelegt haben. Ja, die Herren Leutnants haben auch ihre Schwächen und kleinen Fehler, wenn sie in voller Uniform einherstolzieren, das selbstverständlich randlose Monokel im Auge, die Hose so steif gebügelt, daß diese von alleine stehen bliebe, wenn sie hingestellt würde und den Säbel, dessen Länge im umgekehrten Verhältnis zu der Größe seines Besitzers steht, stolz auf den linken Unterarm gehängt oder, was noch schicker, ganz tipptopp ist, ihn lang hinter sich herschleppen lassend.
Ganz junge Leutnants finden das sogar „wahnsinnig aufregend” — da kann nach ihrer Überzeugung ein junges Mädchenherz einfach nicht standhaft bleiben, es muß sich verlieben, ja noch mehr, es muß einfach brechen.
Im Vergleich mit all den Eroberungen, die nach seiner Meinung ein junger Leutnant macht, ist Napoleon, der große Eroberer, einfach ein ungeborener Waisenknabe — der Mann kommt in der Hinsicht überhaupt nicht in Frage. Lächerlich! 'ne Provinz erobern kann jeder, wenn er genug Soldaten hat, aber ein Herz knicken, das sich nicht knicken lassen will und doch geknickt werden muß, das ist 'ne Sache, das kann nicht jeder, das kann nur ein Leutnant.
Einem Leutnant imponiert nichts auf der Welt, garnichts, höchstens die Millionen, die er nicht hat, aber verdammt gerne haben möchte, denn das Gehalt ist nur knapp und die Zulage meistens sehr gering. Aber da gilt für ihn das Wort: Nur nichts merken lassen! Ist der Beutel auch noch so leer, das schadet nichts, nach außen hin ist er stets tadellos gekleidet und er tritt mit einer Ruhe und Sicherheit auf, als gehöre ihm die halbe Welt. Und warum auch nicht? Was andere Menschen sich oft erst sehr mühsam erringen müssen, eine geachtete gesellschaftliche Position, die hat er von dem Tage an, an dem er durch Allerhöchste Kabinettsordre zum Leutnant befördert wurde und an dem er dem Posten, der zum ersten Mal vor ihm das Gewehr präsentierte, nach uraltem Brauch in der Armee einen Taler in die Hand drückte. Es gibt kein Haus, keinen Salon, in dem man es sich nicht zur hohen Ehre anrechnet, wenn die Offiziere dort verkehren, und selbst der jüngste Leutnant ist hoffähig. Der Leutnant spielt auf allen Gesellschaften die erste Rolle. Nicht nur die jungen Damen verwöhnen das Militär, sondern die Zivilisten tun das eigentlich noch mehr. In einem Offizierskasino zu Gaste geladen zu werden, gilt für zahllose Zivilisten als eine Auszeichnung und viele sind stolz, wenn sie mit einem Leutnant zusammen durch die Straßen gehen können. Aber natürlich nur dann, wenn er in Uniform ist, denn ein Leutnant in Zivil — nein, das ist eigentlich gar kein Leutnant. Für unsere Leutnants ist es wirklich ein wahres Glück, daß die Kabinettsordre des verstorbenen Kaiser Friedrich nicht in Kraft trat, die da bestimmt hatte, daß die Offiziere die Uniform nur im Dienst und bei Hofe zu tragen hätten, daß sie sonst aber stets in Zivil erscheinen sollten. Wäre die Ordre in Kraft getreten, dann hätten die Offiziere, wenigstens die jungen Leutnants, sehr schnell ihre Rolle in der Gesellschaft ausgespielt gehabt. Aber auch für die jungen Mädchen ist es ein Glück, daß alles so blieb, wie es war, denn das Schönste an einem Husarenleutnant sind doch die hohen Lackstiebel und die engen Beinkleider, die aber nach der neuesten Mode weit, ganz weit, am liebsten sogar noch weiter getragen werden.
Auch für die Leutnants gibt es ebenso wie für die Damen eine Mode, natürlich ist die verboten, und die Vorschriften über Farbe und Beschaffenheit der Uniformen und Ausrüstungsstücke wie Mütze, Helm, Stiefel, Säbel, sind sehr genau und ihre Durchführung wird streng kontrolliert, aber gerade weil die Mode verboten ist, hat sie zahlreiche Anhänger. In erster Linie natürlich unter den jungen Leutnants, denn die finden alles Vorschriftsmäßige einfach „kommissig” und alles, was mit dem Kommiß, dem Dienst, zusammenhängt, das ist einfach „kommissig”, das heißt plebejisch. Und um nach außen hin als ein ganz patenter Kerl zu erscheinen, läßt sich der junge Leutnant ganz spitze Stiefel „bauen”, selbstverständlich, wenn es seine Mittel irgend erlauben, bei dem Hofschuhmachermeister von S.M., und vor allen Dingen läßt er sich ganz hohe Kragen auf die Röcke setzen, je höher desto besser. wenn die Dinger auch noch so unbequem sind, wenn sie ihn bei jeder Kopfbewegung auch noch so sehr hindern, das schadet nichts. Im Gegenteil, immer noch höher, das ist totschick, einfach Puppe. Und wenn dann eine junge Dame einen Offizier auf einer Gesellschaft fragt: „Aber, Herr Leutnant, wie halten Sie es denn nur in dem Hohen Kragen aus?” dann ist der Leutnant sehr stolz, daß sein Kragen Aufsehen erregt hat und sagt dann voll Stolz und Bescheidenheit: „Ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, der ist doch nicht hoch? Da hätten gnädiges Fräulein mal meinen Kameraden von Aberg von den Ulanen kennen lernen müssen. Ich sage Ihnen, gnädiges Fräulein, der hatte einen Kragen, der wirklich ein Kragen war. Der war so hoch, daß eine Fliege drei Tage und drei Nächte brauchte, bis sie an dem in die Höhe gekrabbelt war. Nee, wirklich, gnädiges Fräulein, Sie brauchen garnicht zu lachen, das ist Tatsache, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. und als wir mal von einem alten Rock einen seiner Kragen abschnitten und den als Hindernis in die Reitbahn stellten, da kam von allen Gäulen nur einer drüber und der Schinder auch nur deshalb, weil er bei dem Sprung mit den Vorderbeinen das Hindernis umschlug.”
Ein junger Leutnant hat die wunderbarsten Dinge erlebt und im Übertreiben ist er groß. Das lernt er schon im Kadettenkorps, da sprechen die jungen Leute von ihrem Turnlehrer nie anders als von dem besten Turner der ganzen Armee, der Gaul, auf dem sie reiten, und den sie nur mit Mühe zum Traben bringen können, ist das wildeste Pferd, das es überhaupt jemals gab und das sich bisher noch von keinem anderen hat bändigen lassen. Ihr Reitlehrer hat in früheren Jahren auf sämtlichen Rennplätzen sämtliche Rennen gewonnen und an Preisen viele Millionen eingesteckt. Die Kadetten sind von der Wahrheit dessen, was sie sagen, völlig und fest überzeugt. Diese Übertreibung geht ihnen in Fleisch und Blut über, wie die ihnen ebenfalls im Kadettenkorps eingeimpfte Überzeugung, daß es auf der Welt nur einen Stand und nur einen Beruf gibt: den Offizier. Gewiß hat die einseitige Erziehung ihre großen Schattenseiten, aber der Leutnant, der sich bei dem heutigen Dienstbetrieb, namentlich in kleinen Garnisonen, wo man nichts anderes als den Dienst kennt, für seine paar Groschen Gehalt ganz gehörig quälen muß, hat als einziges Entgelt für alle Mühe und Arbeit ja auch weiter nichts als das stolze Bewußtsein, Leutnant und der Vertreter und der Angehörige einer ganz besonders hoch dastehenden Kaste zu sein. Wenn man einem Leutnant den Glauben rauben würde, mehr zu sein als andere Menschen, so wäre es ungefähr dasselbe, als wenn man einen Mondsüchtigen, der auf dem schmalen First des Daches spaziert, anrufen würde — es wäre sein Tod.
Der beste Verkehr für den Offizier ist und bleibt der Offizier, hat Seine Majestät, unser jetziger Kaiser, seinen Offizieren vor einigen Jahren zugerufen, und diese Abgeschlossenheit, in der unsere Offiziere trotz aller Geselligkeit, die sie pflegen, doch im großen und ganzen leben, ist in erster Linie die Veranlassung zu den häufig etwas veralteten Anschauungen, die namentlich bei den ganz jungen Leutnants sehr häufig herrschen. Namentlich das Arbeiten, um Geld zu verdienen, gilt als unbegreiflich und nicht standesgemäß. Als ich noch in Hamburg Leutnant war, habe ich es selbst erlebt, daß ein neu in das Regiment versetzter Kamerad es geradezu unbegreiflich fand, daß die Offiziere bei den Hamburger Kaufleuten verkehrten, bis er dann später doch zu der Erkenntnis kam, daß ein Hamburger Großkaufmann doch etwas ganz anderes ist als ein Tütendreher in der kleinen Stadt. Übrigens passierte in Hamburg einmal ein sehr niedlicher Witz. Ein Offizier wurde von einem Großkaufmann auf die Börse geführt. Der Leutnant hatte keine Ahnung, was eine Börse ist, er glaubte, er befände sich in dem Geschäft seines liebenswürdigen Begleiters und als er dann an dessen Seite von der Galerie herab das Leben und Treiben all der zahllosen Kaufleute betrachtete, die da ihre Geschäfte abschlossen, da brach er in den Ruf aus: „Donnerwetter, einfach fabelhaft! Soviel Angestellte haben Sie?”
Auch die schriftstellerische Tätigkeit bewertet der Leutnant hicht allzuhoch, lesen tut er nur wenig. Im Hause einer Verwandten von mir verkehrte früher sehr viel ein junger Leutnant, der regelmäßig jeden Freitag kam, um sich dann eine englische Zeitschrift, die wöchentlich erschien, auszubitten und mit nach Haus zu nehmen. Eines Tages wurde er gefragt, warum ihn gerade dieses Blatt so interessiere, daß er es regelmäßig zu lesen wünsche, und da gab er zur Antwort: „Es hat so wunderhübsche Illustrationen.”
Jeder Leutnant ist ein geborener Geschichtenerzähler und daß er dabei sehr häufig die Pointen mordet, ist nicht imstande, ihn von seiner Leidenschaft zu kurieren. Als ich noch Leutnant war, machte ich in gegebener Veranlassung einmal den Vers:
|
Im Wonnemonat Mai juchhe! |
Sofort eilte ein Kamerad, der das mit angehört hatte, zu den übrigen: „Kinder, wißt Ihr schon den neuesten Witz? Im Wonnemonat Mai hurrah! Da kommt der Kommandierende.” Dann aber wurde er ganz nachdenklich und meinte sehr erstaunt: „Das geht nicht mit rechten Dingen zu, eben hat es sich doch gereimt.”
Jeder Leutnant erlebt nach seiner Meinung täglich Dinge, die einen brillanten Stoff für eine Militärhumoreske gäben. Auch dafür ein kleines Beispiel, für dessen Wahrheit ich mich verbürge. Ich traf einmal mit einem Husarenleutnant zusammen, den ich lange Zeit nicht gesehen hatte, und kaum bemerkte er mich, als er auf mich zustürzte: „Schön, daß ich Sie endlich mal treffe, ich wollte Ihnen schon schreiben und Sie um eine Zusammenkunft bitten, denn ich habe eine Geschichte für Sie, ich sage Ihnen, eine Geschichte, mit der können Sie Tausende von Mark verdienen.”
„Na, ganz so viel wird es wohl nicht werden,” widersprach ich, „aber ich bin auch mit weniger zufrieden.”
„Aber für nichts ist nichts,” meinte er, „eine Pulle Sekt will ich wenigstens von Ihrem Verdienst abhaben und da man nicht wissen kann, wann wir uns wiedersehen, könnten Sie sie eigentlich gleich zum Besten geben.”
Ich stimmte bei: „Schön, aber nur unter der Bedingung, daß Sie zwei Flaschen bezahlen, wenn ich die Sache nicht verwerten kann.”
Er war ganz beleidigt: „Ausgeschlossen, lieber Freund, ganz ausgeschlossen, daß Sie die Sache nicht gebrauchen können. Ich sage Ihnen, so 'ne Geschichte, wie die Geschichte, das ist schon bald gar keine Geschichte mehr, das ist ein ganzer Roman.”
Und als wir dann bei dem Sekt zusammensaßen, erzählte er: „Also vor ein paar Wochen da hatten wir mal wieder 'ne große Übung mit der Infanterie zusammen, natürlich da ganz draußen, wo für gewöhnlich kein lebendes Wesen mehr hinkommt. Na, wie die Geschichte denn losgeht, erhalte ich den ehrenvollen Auftrag, die erste Offizierspatrouille zu reiten, und als ich gleich darauf mit meinen drei Husarenleutnants hoch zu Roß die Chaussee entlang schlendere, da sehe ich zu meinem Erstaunen, und ich gebe Ihnen mein Wort, ich war wirklich erstaunt, daß rechts von der Chaussee ein Feldtelegraph gelegt wird, Sie verstehen mich doch, ein Feldtelegraph. Und da kam mir mit einem Mal der Gedanke: Donnerwetter, nun müßte mal einer mit 'ner großen Schere kommen und diesen Feldtelegraphendraht durchschneiden.”
Der Erzähler schwieg und sah mich erwartungsvoll an.
„Na und weiter?” fragte ich.
Und stolz und siegesgewiß um sich blickend, sagte er: „Da habe ich sofort an Sie gedacht und mir gesagt, das muß du dem Schlicht erzählen, daraus kann er eine feine Militärhumoreske machen.”
Daß ein Leutnant von Pferden und Hunden mehr versteht als alle anderen Menschen zusammen, ist zu bekannnt, als daß es nötig wäre, darüber noch ein Wort zu verlieren, aber er ist auch ein großer Kunstkenner. Auch in der Hinsicht habe ich etwas erlebt. In einer großen Garnison wollte ein Offizierkorps sich für das Kasino ein neues Portrait seines Landesherrn anschaffen und ein Leutnant wurde beauftragt, sich mit einem in der Stadt wohnenden Portraitmaler in Verbindung zu setzen und diesen zu fragen, ob und zu welchem Preise er das Bild malen wolle.
Der Maler erkundigte sich, ob das Bild in Öl oder in Pastell ausgeführt werden solle, und um dem Leutnant den Unterschied klar zu machen, zeigte er ihm verschiedene Portraits, die er in seinem Atelier stehen hatte.
Aber der Leutnant schüttelte den Kopf: „Nee, so was wollen wir nicht, wir hatten uns das Bild so gedacht, wie das in der Kunsthandlung von X ausgehängte, nur in Lebensgröße.”
Und als der Maler sich dann später das dort ausgestellte Bild ansah, war es eine kolorierte Photographie.
Es passiert dem Leutnant sehr oft, daß er sich mit dem, was er sagt, vergaloppiert, aber das schadet nichts, und kein Leutnant nimmt es übel, wenn man ihn auf den Unsinn, den er redet, hinweist, er lacht dann fröhlich über seine eigene Torheit mit, was schadet das auch, wenn er mit seinen Anschauungen und Behauptungen ganz alleine dasteht, er ist doch ein ganzer Kerl.
Ein Leutnant nimmt es auch garnicht übel, wenn er zum Gegenstand des Witzes oder der Karikatur gemacht wird, das schmeichelt sogar seiner Eitelkeit, denn an kleine Geister wagt sich der Witz und die Karikatur doch nicht heran, nur an große, wie die Fürsten dieser Welt oder die Staatsmänner à la Bismarck. So kommt es auch, daß in den Offizierkorps die Leutnantsbilder von Meister Thöny, der übrigens in seinem Leben nie Soldat gewesen ist, von Heilemann und all den anderen Künstlern die größten Verehrer finden, aber nie wird ein Leutnant zugeben, daß es solche Typen, die doch sehr häufig dem Leben abgelauscht sind, wirklich gibt. Aber er amüsiert sich königlich über die Bilder und lacht sich halbtot, wenn er im Simplicissimus den Witz liest: „Vater, wir werden auf der Eisenbahn noch so lange 2.Klasse fahren, bis wir Läuse haben.”
Der Leutnant ist der fröhlichste und lustigste Mensch auf der Welt. Sorgen macht er sich nicht. Er stöhnt und klagt manchmal, wenn er kein Geld hat, aber eine oder mehrere Flaschen Sekt, die nichts kosten, weil sie ebenso wie ihre Vorgänger und Nachfolger in Erwartung besserer Zeiten aufgeschrieben werden, trösten ihn schnell wieder und bringen ihn von neuem zu der Überzeugung, die er im Grunde seines Herzens immer hatte, daß er das beneidenswerteste Geschöpf aller zweibeinigen Geschöpfe und daß dieses Leben von allen Leben doch das Schönste ist.
Nur wenn eine Besichtigung vor der Tür steht und wenn die ganz hohen Vorgesetzten in Sicht sind, verwünscht er sich und seinen Beruf oft, aber dann tröstet ihn doch wieder die Gewißheit, daß die Vorgesetzten nicht nur kommen, sondern daß sie auch wieder gehen. Und schließlich: Angenehm ist es ja nicht, etwas auf den Hut zu bekommen, aber gestorben ist daran noch keiner und jede Besichtigung endet mit einem Besichtigungsessen, das oft sehr viel länger dauert als die Besichtigung selbst, das vor allen Dingen aber viel lustiger und amüsanter ist. Und anstatt zu schelten, daß die Vorgesetzten kommen, freut er sich sogar sehr bald darauf, nicht weil sie kommen, sondern weil sie die Veranlassung zu einem feuchtfröhlichen Liebesmahl sind. Und von neuem sieht er ein, daß kein Unglück so groß ist, daß es nicht den Keim zu einem neuen Glück in sich birgt.
Fußnote:
Diese Erzählung „Der Leutnant in der Karikatur” ist im Jahre 1924 als einzige Erzählung nicht aus dem Band „Richtung, Fühlung, Vordermann!” in den Band „An die Gewehre” aufgenommen worden, der ansonsten auch noch Erzählungen aus dem Band „Excellenz ist wütend” enthält. Diese Erzählung war in den Nachkriegsjahren in keiner Weise mehr zeitgemäß.
 |
 |
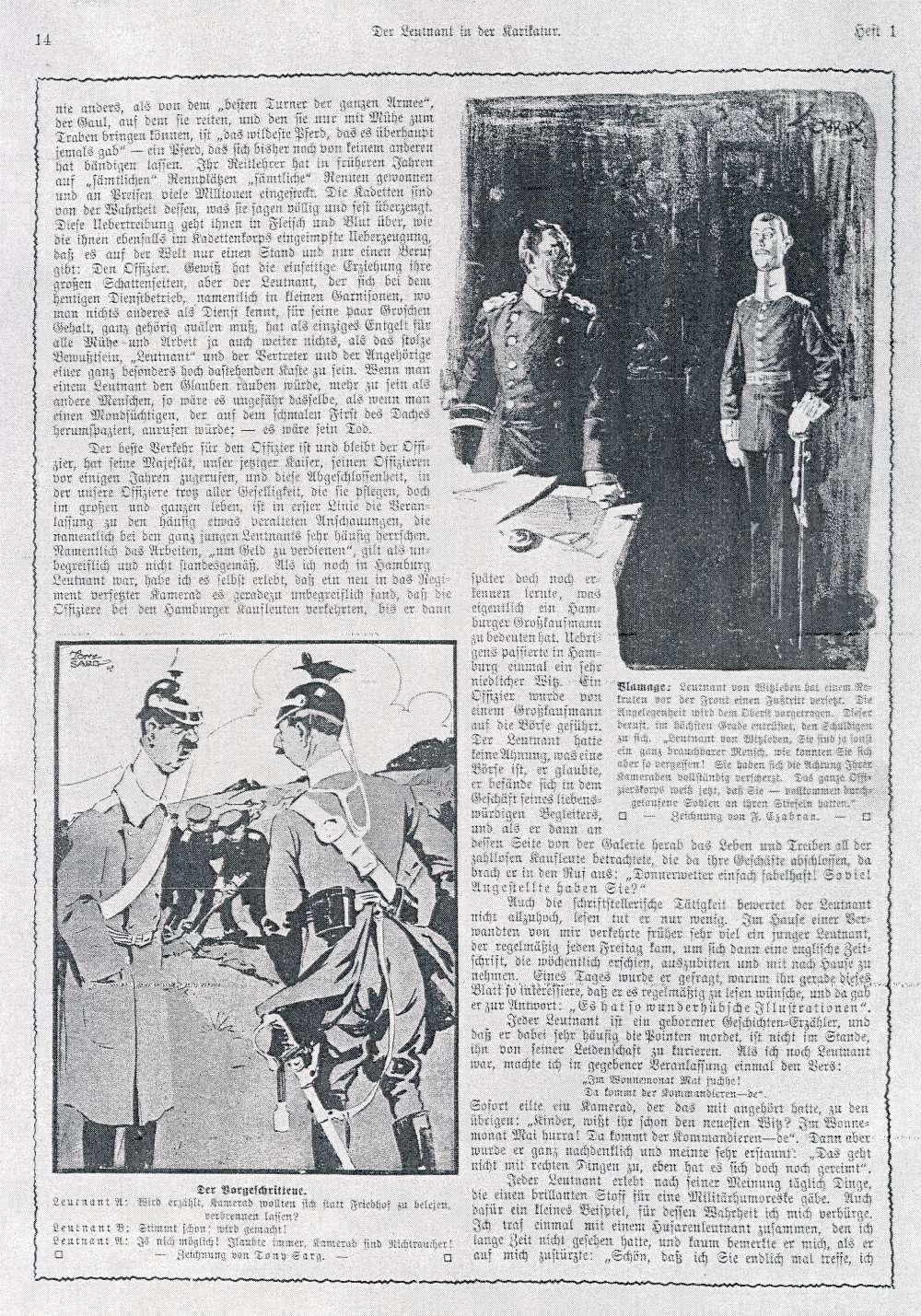 |
 |
Zum Vergrößern ein- bis zweimal anklicken ! | |||